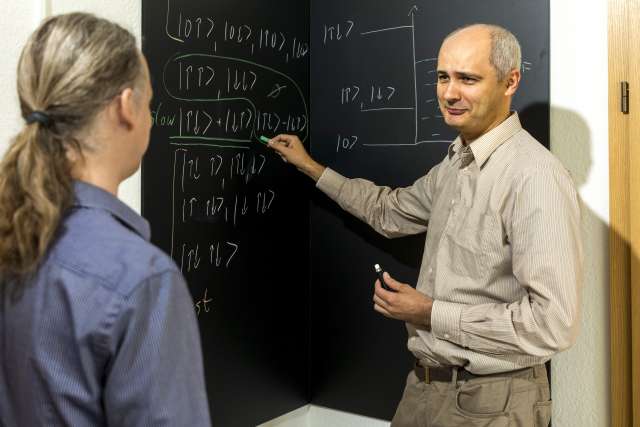Den Urknall im Labor nachahmen
Physik-News vom 22.10.2018
Auch wenn wir die Ereignisse während der Entstehung des Weltraums wohl nie direkt nachahmen können, stehen die Chancen gut, vergleichbare Vorgänge im Labor zu simulieren. So lässt sich die Teilchenbildung kurz nach dem Urknall mit einer in vielen Labors genutzten Ionenfalle zumindest in einiger Hinsicht nachahmen. Wie das funktioniert, erklären jetzt Ralf Schützhold vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Christian Fey von der Universität Hamburg sowie Tobias Schaetz von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in der Fachzeitschrift „Physical Review A“.
Am Anfang war die Welt wüst und leer. In den Augen eines theoretischen Physikers wie dem HZDR-Forscher und Professor an der TU Dresden, Ralf Schützhold, stimmt diese Aussage nur bedingt. Denn die Theorien erklären zwar, wie das Universum, das wir heute kennen, sich nach dem Urknall in einer Art Inflationsphase unvorstellbar rasch vergrößerte. „Nur war das Vakuum in diesen ersten winzigen Bruchteilen von Sekunden nicht völlig leer, sondern es gab dort Fluktuationen“, erklärt Schützhold eine nur schwer vorstellbare Aussage der Quantenfeldtheorie.
Publikation:
Christian Fey, Tobias Schaetz, Ralf Schützhold
Ion-trap analog of particle creation in cosmology
Physical Review A
DOI: 10.1103/PhysRevA.98.033407
Allerdings bedeutet „Vakuum“ in der Physik nur, dass es dort keine Materie in Form von Molekülen, Atomen oder Elementarteilchen gibt. Zum Beispiel elektrische oder magnetische Felder existieren durchaus. Sie verteilen sich aber nicht völlig gleichmäßig, sondern sind an einigen Stellen ein wenig stärker oder schwächer. Sobald die Inflationsphase beginnt und sich das immer noch winzig kleine Universum extrem rasch und stark aufbläht, reißt es diese Fluktuationen – angetrieben von gigantischen Kräften – schlagartig auseinander. Dabei können sich die gewaltigen Energien in Materie umwandeln. So entsteht ein Paar von Elementarteilchen, die sich in einer Eigenschaft grundlegend unterscheiden: Zum Beispiel kann sich ein Elektron mit einer negativen elektrischen Ladung gemeinsam mit seinem „Positron“ genannten Gegenstück mit einer positiven elektrischen Ladung bilden.
Damals entstanden auch viele andere Elementarteilchen. Diese „Paarbildung“ in einem unvorstellbar kurzen Moment am Anfang der Geschichte des Kosmos sollte für das spätere Schicksal des Universums und für unsere eigene Existenz noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Überall dort, wo sie auftauchte, gab es eine kleine Unregelmäßigkeit, Inhomogenitäten entstanden.
Genau an diesen Unregelmäßigkeiten veränderte sich die Temperatur. Diese winzigen Wärme-Schwankungen können Astrophysiker noch heute in der Hintergrundstrahlung nachweisen, die aus den Tiefen des Weltraums zu uns dringt. Das Echo des Urknalls hallt also 13,8 Milliarden Jahre später immer noch nach. Die Paarbildung an solchen Fluktuationen sorgte auch dafür, dass die Teilchen sich nicht völlig gleichmäßig im Weltraum verteilen. An den Stellen, an denen sich etwas mehr Teilchen als andernorts befanden, war auch die Schwerkraft ein wenig stärker. Die erhöhten Konzentrationen zogen daher noch mehr Materie an und wurden so noch größer, bis sich schließlich aus diesen Ansammlungen riesige Galaxien bildeten, die aus vielen Milliarden Sternen bestehen. Erst diese Galaxien und ihre Sonnen aber schufen die Möglichkeiten für Leben, wie wir es von der Erde kennen.
Über die Paarbildung am Anfang dieser Entwicklung hat bereits der berühmte Wiener Physiker Erwin Schrödinger nachgedacht. Irène und Frédéric Joliot-Curie beobachteten 1933 zum ersten Mal, wie ein Elektronen-Positronen-Paar aus Lichtenergie entstand. „Die Paarbildung aus den auseinander gerissenen Fluktuationen in der inflationären Phase des Weltraums aber befindet sich leider weit außerhalb unserer Möglichkeiten“, erklärt Schützhold, der am HZDR seit kurzem die Gruppe „Theoretische Physik“ aufbaut.
Daher gibt es immer wieder Vorschläge, wie sich diese Theorie in der Praxis überprüfen lässt. Gemeinsam mit Christian Fey von der Universität Hamburg und Tobias Schaetz von der Universität Freiburg legt Ralf Schützhold in der Zeitschrift „Physical Review A“ jetzt einen neuen Vorschlag vor: Tobias Schaetz könnte die Paarbildung in der inflationären Phase mit Hilfe einer „Ionenfalle“ nachahmen.
Ein elektromagnetisches Feld hält in einer solchen Ionenfalle zum Beispiel elektrisch positiv geladene Magnesium-Ionen so fest, dass sie sich nur entlang der Mittelachse eines Zylinders bewegen können. Ein zweites elektromagnetisches Feld fixiert nun das Ion an einer bestimmten Stelle der Mittelachse. Halten elektromagnetische Felder unmittelbar daneben in einem Abstand von wenigen tausendstel Millimetern ein zweites, ebenfalls positiv geladenes Magnesium-Ion fest, stoßen sich die beiden positiven elektrischen Ladungen stark ab.
Lockern die Forscher nun ein wenig das elektromagnetische Feld, das die Ionen festhält, schießen beide – angetrieben von der abstoßenden Kraft ihrer gleichen elektrischen Ladungen – in entgegengesetzter Richtung entlang der Achse des Zylinders davon. Manchmal bewegt sich das davonfliegende Ion zusätzlich ein klein wenig senkrecht zu dieser Achse. Stellen die Forscher eine solche Schwingung bei einem der Ionen fest, verlangen die Gesetze der Quantenphysik, dass auch der in die andere Richtung davonschießende Partner mit der gleichen Energie schwingt. Ähnliches gilt für die Paarbildung beim Auseinanderreißen im frühen Universum.
„Verschränken“ nennen theoretische Physiker dieses Phänomen, bei dem die beiden gemeinsam entstandenen Teilchen sich weit voneinander entfernen können, aber bestimmte Merkmale immer noch die gemeinsame Herkunft verraten. Und da diese Verschränkung sehr wichtig für den Bau von extrem leistungsfähigen Quantencomputern ist, investieren die Forscher mit dem Nachahmen der Vorgänge beim Urknall in Ionenfallen auch eine klein wenig in eine Zukunftstechnologie.
Diese Newsmeldung wurde via Informationsdienst Wissenschaft erstellt.